Verkehrsclub Deutschland Landesverband Nordrhein-Westfalen
VCD Tourismustag 1997 in Burg an der Wupper - Nachhaltiger Tourismus: Ideen – Konzepte – Märkte
Der erste Tourismustag des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) NRW fand 1997 auf Schloss Burg an der Wupper statt und widmete sich dem Leitgedanken eines nachhaltigen, umweltverträglichen Tourismus. Ziel der Veranstaltung war es, innovative Ideen und praxistaugliche Konzepte für eine umweltfreundliche Freizeit- und Urlaubsmobilität zu präsentieren, die den wachsenden Anforderungen an Klimaschutz, Ressourcenschonung und Lebensqualität gerecht wird. Mehr als fünfzig Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Tourismus, Verkehrspolitik, Umweltverbänden, Kommunen und Wissenschaft diskutierten, wie Tourismus und Mobilität künftig so gestaltet werden können, dass ökologische Verantwortung und wirtschaftliche Chancen im Einklang stehen.
Einleitende Worte – Julia Freiwald, Bürgermeisterin von Solingen
Julia Freiwald betonte in ihrem Grußwort die besondere Bedeutung der regionalen Naherholung. Schloss Burg und die Müngstener Brücke seien herausragende touristische Anziehungspunkte, die jedoch bislang nur unzureichend mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar seien. Sie kritisierte das vorherrschende Leitbild des Fernreisens und verwies auf die ökologischen sowie seelischen Belastungen, die durch den zunehmenden Individual- und Flugverkehr verursacht werden. Erholung müsse nicht mit weiten Reisen verbunden sein, erinnerte Freiwald, denn früher hätten Familien überwiegend nahegelegene Ziele genutzt. Nachhaltiger Tourismus biete die Chance, regionale Naherholung aufzuwerten, Natur und Kultur zu bewahren und zugleich sozial gerechter zu gestalten.
Beiträge der Referenten
Nachhaltiger Tourismus und Verkehrswende – Achim Walder (VCD NRW, Tourismusexperte)
Walder betonte die Dringlichkeit eines grundlegenden Umdenkens im Freizeitverkehr, der als am stärksten wachsender Verkehrssektor besonders empfindliche Naturräume belastet. Über 50 Prozent des Freizeitverkehrs in Deutschland werde mit dem Auto durchgeführt, der Flugverkehr nehme weiter zu und verschärfe die ökologischen Probleme erheblich. Der VCD NRW wolle mit einem jährlich stattfindenden Tourismustag Anreize für Freizeit und Urlaub ohne Auto geben, Alternativen vorstellen, Mobilitätsberatung fördern und Beispiele für gelungenen umweltfreundlichen Urlaub präsentieren. Erholung ohne Lärm, Abgase und lange Anreisen müsse wieder als zentrales Qualitätsmerkmal verstanden werden. Nachhaltiger Tourismus könne nur gelingen, wenn An- und Abreise konsequent auf umweltfreundliche Verkehrsmittel wie Bahn, Bus und Fahrrad verlagert werden. Erfolgreiche Beispiele wie autofreie Täler, Radfernwege und kombinierte Mobilitätsangebote zeigten, dass Urlaub ohne Auto nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch attraktiv sei. Walder forderte klare politische Vorgaben, einheitliche Qualitätsstandards, verlässliche ÖPNV-Anbindungen und eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Verkehrsverbünden und touristischen Anbietern. Nachhaltiger Tourismus müsse als zukunftsweisendes Leitbild verstanden werden, das ökologische Verantwortung mit wirtschaftlichen Chancen verbindet.
Wie verträglich ist der touristische Verkehr – Prof. Karl Otto Schallaböck (Wuppertal-Institut)
Schallaböck analysierte die ökologischen Nebenwirkungen des Tourismus und unterschied vier Problemfelder: negative soziale und ökonomische Effekte in Quell- und Zielregionen sowie ökologische Belastungen in den Zielgebieten und durch den Transport. Der Luftverkehr wurde als größter Wachstumsfaktor und Klimabelastung hervorgehoben. Er verursache bis zu 6 Prozent des globalen Treibhauseffekts, obwohl nur ein kleiner Teil der Bevölkerung fliegt. Prognosen gingen von einer Vervierfachung des Luftverkehrs bis 2020 aus, was Klimaziele massiv gefährde. Schallaböck forderte die Besteuerung von Kerosin, Preiswahrheit im Verkehr, eine Förderung technischer Innovationen sowie eine Stärkung des öffentlichen Verkehrs. Individuelle Verhaltensänderungen seien ebenso notwendig.
Umwelt und Tourismus – Friedhelm Ernst (Deutscher Fremdenverkehrsverband Rheinland)
Ernst sah in einem umweltverträglichen Tourismus ein wichtiges Qualitätsmerkmal, das langfristig auch ökonomisch vorteilhaft sei. Gäste schätzten zunehmend ruhige, naturnahe Reiseziele, wodurch sich für Destinationen Chancen für nachhaltige Angebote ergäben. Tourismus und Umweltschutz seien aufeinander angewiesen und erforderten klare gesetzliche Regelungen, um Umweltbelastungen zu reduzieren. Verkehrsprobleme sollten durch bessere Vernetzung von Fern- und Nahverkehr sowie durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs gelöst werden. Wettbewerbe wie „Umweltfreundliche Fremdenverkehrsorte“ hätten gezeigt, dass umweltorientierte Angebote erfolgreich sein können.
Verbesserung der Mobilitätsberatung – Matthias Seiche (B90/Die Grünen)
Seiche forderte eine bessere Information der Reisenden über umweltfreundliche Anreisemöglichkeiten. Tourismusverbände müssten aktiv Mobilitätsberatung leisten, zum Beispiel durch integrierte Fahrplanauskünfte, Hinweise auf Bahn- und Busverbindungen sowie auf Fahrradverleihstationen. Prospekte sollten konkrete Beispielverbindungen, Preisangaben und Tipps zu Freizeitgestaltung ohne Auto enthalten. Sanfte Mobilität müsse zum Imagefaktor werden, indem authentische Darstellungen von Wanderbussen oder Radwegen die bisherigen Werbeklischees ersetzten.
Zukunft eines umweltverträglichen Tourismus in NRW – Rolf Spittler (BUND)
Spittler analysierte Chancen und Hemmnisse eines umweltverträglichen Tourismus in Nordrhein-Westfalen und forderte grundlegende Reformen, um den Tourismus an Nachhaltigkeitskriterien auszurichten. Der Tourismus wachse weltweit rasant und verursache massive Umweltbelastungen, weshalb das Wachstum begrenzt und Urlaubsziele näher an die Wohnorte gerückt werden müssten. Sanfter Tourismus bedeute die umfassende, umwelt- und sozialverträgliche Umgestaltung der gesamten Tourismusindustrie. Flugreisen seien der größte Klimafaktor im Tourismus, dennoch fehle es an politischen Vorgaben zur Begrenzung des Verkehrs. Spittler forderte ein Landesprogramm für umweltverträgliche Tourismusentwicklung, die Anpassung von Förderprogrammen, die Förderung regionaler Konzepte, die Einrichtung von Umweltbeauftragten sowie Modellprojekte mit Vorbildcharakter.
Fahrradtourismus als Wirtschaftsfaktor – Thomas Froitzheim (ADFC)
Froitzheim zeigte auf, dass Fahrradtourismus erhebliche regionale Wertschöpfung generiert und gleichzeitig umweltfreundlich ist. Regionen wie das Münsterland oder das Moseltal konnten ihre Übernachtungszahlen entgegen dem bundesweiten Trend steigern. Radreisende gaben mit durchschnittlich 100 bis 150 DM pro Tag überdurchschnittlich viel aus. Veranstaltungen wie autofreie Täler zogen Hunderttausende an, und in Schleswig-Holstein wurden über ein Drittel der touristischen Umsätze dem Fahrradtourismus zugeschrieben. Trotz vieler Initiativen fehle es an koordinierter, langfristiger Planung und einheitlichen Qualitätsstandards. Froitzheim betonte die Notwendigkeit nachhaltiger Investitionen, professioneller Vermarktung und besserer öffentlicher Verkehrsanbindungen für den Radtransport.
Nachhaltiges Verkehrskonzept für Qualitätstourismus – Anja Boss, Claudia Boss, Karin Fetzer und Ingo Thäte
Das Team stellte ein Konzept vor, das Nachhaltigkeit als zentrales Qualitätskriterium definiert. Umweltfreundliche Mobilität sei entscheidend für den Tourismus der Zukunft und steigere die Attraktivität der Reiseziele. Touristische Anbieter müssten ökologische Standards erfüllen und die Kooperation mit Verkehrsunternehmen ausbauen, um integrierte, umweltfreundliche Angebote zu schaffen.
Umweltverträglicher Tourismus im Bergischen Land – Frank Schopphoff (Pro Bahn)
Schopphoff verwies auf bestehende umweltfreundliche Angebote wie die Umweltverbundkarte Rhein-Berg, die autofreies Reisen im Bergischen Land erleichtert. Er plädierte für eine bessere Vermarktung solcher Angebote, den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und die stärkere Einbindung von Bahn und Bus in touristische Werbekonzepte.
Naherholung aus Verbrauchersicht – Dirk Wendland (Verbraucherzentrale NRW)
Wendland stellte dar, dass viele Verbraucher attraktive Naherholungsangebote suchen, die kostengünstig, umweltfreundlich und gut erreichbar sind. Diese Nachfrage müsse stärker bedient werden, indem Naherholungsziele besser beworben und an den öffentlichen Verkehr angebunden werden. Verbraucher wünschten sich qualitativ hochwertige Angebote ohne lange Anreisewege.
Sanfter Tourismus aus Sicht eines Reisebüros – Harald Scharwächter (K.O.R.B. Reisen)
Scharwächter betonte, dass auch Reisebüros mehr umweltfreundliche Angebote ins Programm aufnehmen sollten. Nachhaltige Reisen könnten als Qualitätsreisen positioniert und gezielt vermarktet werden, um neue Kundengruppen anzusprechen. Reisebüros hätten die Aufgabe, umweltorientierte Reisen als attraktives Angebot zu präsentieren und gleichzeitig Beratung zu umweltfreundlicher Mobilität zu leisten.
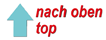
Herausgeber
Redaktion: Achim Walder - Ingrid Walder
Text: Achim Walder und Freunden
Fotos und Texte, wenn gekennzeichnet, wurden von Freunden freundlicherweise bereitgestellt.
Hinweis auf Urheberrechte. Bitte beachten Sie, dass alle Urheberrechte der Bilder und Dokumente dieser Internetseite beim Walder-Verlag und den Fotografen liegen. Die Nutzung, auch auszugsweise, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Verlags oder der Fotografen möglich. Die Veröffentlichung von Bildern und Texten auf nicht autorisierten Internetseiten oder Druckerzeugnissen untersagen wir ausdrücklich. Bei Missbrauch behalten wir uns rechtliche Schritte vor. Widerruf vorbehalten.
Sponsoring: Die Redaktion bedankt sich bei allen Sponsoren und Anzeigenkunden, die es ermöglichen, Ihnen diesen Reiseführer mit vielen Reisetipps und Freizeitattraktionen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Anzeigen sind grau hinterlegt.
Impessum und Datenschutz
